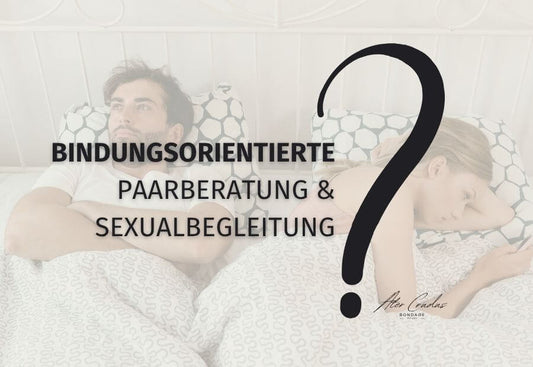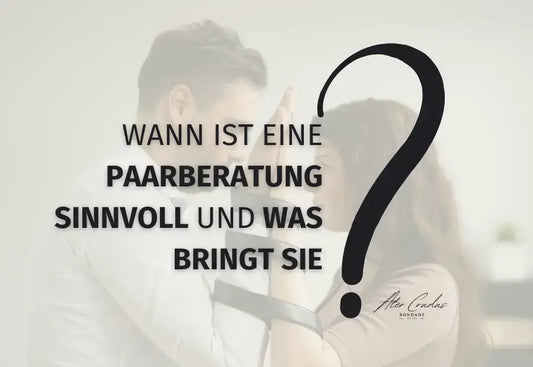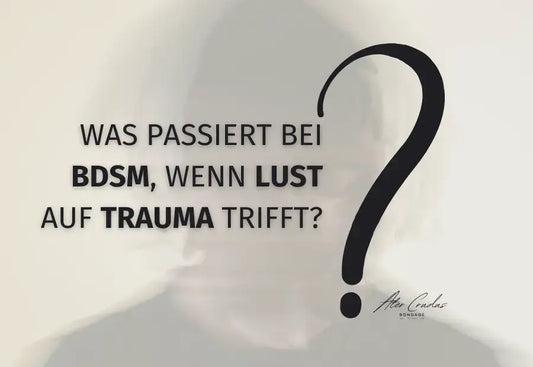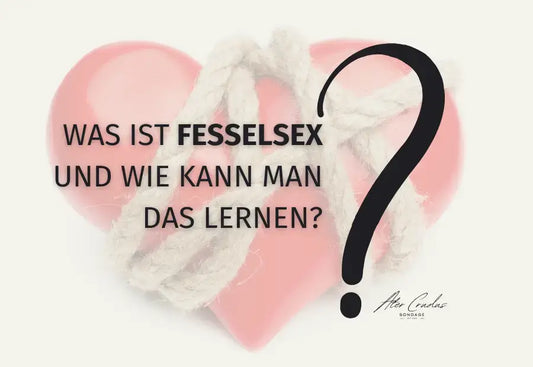BDSM, Trauma & Dynamik: Zwischen Risiko, Ressource und Selbstmacht
Ater CrudusFür manche ist es reine Lust, für andere ein Tabu – BDSM bewegt sich irgendwo zwischen Kontrolle, Hingabe, Schmerz und Nähe. Doch was passiert, wenn diese Welt auf Menschen trifft, die in ihrer Vergangenheit Gewalt, Missbrauch oder tiefe Verletzungen erlebt haben? Kann BDSM dann helfen, die eigene Geschichte umzuschreiben – oder wiederholt es genau das, was einst wehgetan hat?
Fest steht: BDSM ist weder krankhaft noch automatisch Ausdruck eines Traumas. Aber bei Menschen mit belastenden Erfahrungen kann es eine besondere Rolle spielen – als Risiko, als Spiegel, als Ventil oder als Rettungsanker. Besonders spannend ist dabei ein psychologisches Phänomen, das ganz am Anfang steht:
Die Flucht aus dem Selbst
In manchen Momenten kann BDSM wie ein Portal wirken: Raus aus dem Alltag, raus aus sich selbst. Die eigenen Gedanken verstummen, der Druck fällt ab, alles reduziert sich auf das Jetzt – auf ein Seil, eine Berührung, einen Befehl. Es ist eine intensive Form der Selbstvergessenheit. Der Sozialpsychologe Roy Baumeister beschrieb diesen Zustand schon 1988 als „Escape from Self“ – also als gezielte Auszeit vom Ich, die psychisch entlastend wirken kann.
Aktuelle Forschung zeigt, dass diese Erfahrung auch biologische Grundlagen hat: BDSM kann Stresshormone wie Cortisol senken und gleichzeitig Glücksbotenstoffe wie Endorphine und körpereigene Cannabinoide freisetzen – das konnte eine Studie von Eline Wuyts und ihrem Team 2020 belegen.
Ist BDSM krankhaft?
Nein. Konsensuelle BDSM-Praktiken gelten heute nicht mehr als psychische Störung. In der ICD-11, dem internationalen Diagnosekatalog der Weltgesundheitsorganisation, wurde der Begriff „Sadomasochismus“ als krankhafte Diagnose gestrichen. Der Grund: Einvernehmliche BDSM-Praktiken erfüllen keine Kriterien für eine psychische Erkrankung – sie sind einfach eine sexuelle Ausdrucksform.
Forschende wie Julian Richters und Kolleg:innen zeigten schon 2008, dass Menschen mit BDSM-Vorlieben in der Regel psychisch stabil, sozial integriert und häufig sogar weniger gestresst sind als andere. Auch Andreas Wismeijer fand in seinen Studien, dass viele BDSM-Praktizierende überdurchschnittlich gute Beziehungskompetenz und stabile Bindungsstile aufweisen.
Aber: Was, wenn Trauma im Spiel ist?
So eindeutig BDSM heute als nicht-pathologisch gilt, so komplex wird es, wenn es auf Menschen trifft, die schwere Erfahrungen gemacht haben – etwa in Form von Missbrauch, Vernachlässigung oder Gewalt. Für sie kann BDSM etwas ganz anderes bedeuten als für andere. Forschende haben dabei vier typische Dynamiken identifiziert, die helfen können, dieses Spannungsfeld besser zu verstehen.
1. Reviktimisierung – Wenn sich alte Wunden neu öffnen
Stell dir vor, jemand hat als Kind oder in einer früheren Beziehung Gewalt erlebt. Jahre später findet diese Person Zugang zur BDSM-Szene – auf der Suche nach Nähe, vielleicht auch nach Schutz. Doch statt Sicherheit erlebt sie erneut Übergriffe. Vielleicht, weil sie nicht gelernt hat, ihre Grenzen zu spüren. Vielleicht, weil sie denkt, Gewalt sei ein normaler Teil von Intimität. Oder weil Partner das Label „BDSM“ benutzen, um kontrollierende oder übergriffige Muster zu verschleiern.
Statistisch ist das Risiko, nach erlebter Gewalt später erneut Opfer zu werden, deutlich erhöht. Eine Studie von Classen und Team zeigte, dass zwei von drei Betroffenen nach sexuellen Übergriffen erneut Grenzverletzungen erleben. Weitere Studien, etwa von Littleton und anderen, machen deutlich: Wer traumatisiert ist, kann schwerer „Nein“ sagen, hat öfter Bindungsprobleme oder greift zu Substanzen. All das erhöht das Risiko, erneut in gefährliche Dynamiken zu geraten.
Besonders kritisch wird es, wenn Gewalt unter dem Deckmantel von BDSM ausgeübt wird. Die Forscherin Diana Pitagora warnt ausdrücklich davor, die Sprache der Täter zu übernehmen: BDSM bedeutet Konsens – wer diesen verletzt, agiert nicht im Sinne der BDSM-Kultur, sondern übt schlicht Gewalt aus.
2. Reaktualisierung – Wenn der Körper sich erinnert
Manche Menschen berichten, dass BDSM-Praktiken plötzlich Bilder oder Gefühle hervorrufen, die sie längst vergessen glaubten. Eine bestimmte Berührung, ein Tonfall, ein Geruch – und auf einmal ist alles wieder da. Das Zittern, die Ohnmacht, der alte Schmerz.
Diese Reaktionen sind typisch für posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS). Selbst wenn eine Person bewusst zustimmt, kann ihr Körper in bestimmten Momenten „umkippen“. Es kommt zu Dissoziation, Erstarrung oder einem inneren Film aus früheren Erlebnissen. Melanie Büttner, Expertin für Sexualität und Trauma, beschreibt diese Zustände als „körperliche Flashbacks“, die unabhängig vom Verstand auftreten.
In solchen Momenten ist BDSM kein geschützter Raum mehr, sondern ein unfreiwilliges Wiedererleben – was die alte Wunde erneut aufreißen kann.
3. Rescripting – Wenn BDSM hilft, die eigene Geschichte umzuschreiben
Es gibt Menschen, die sagen: „BDSM hat mir geholfen, Kontrolle zurückzugewinnen.“ Sie entscheiden bewusst, was sie wollen, wo ihre Grenzen sind und mit wem sie sich auf etwas einlassen. Sie erleben, wie es sich anfühlt, gehört zu werden – wie ihr „Stopp“ wirklich zählt.
Diese Form des bewussten Umgangs wird in der Forschung als „Rescripting“ beschrieben – also ein Umschreiben früherer Erfahrungen. Der Begriff „Trauma Play“, geprägt unter anderem von Jennifer Thomas, bezeichnet genau solche Szenarien: Der Mensch wählt freiwillig eine Konfrontation mit dem Schmerz – aber diesmal unter sicheren Bedingungen und mit Kontrolle.
In einer internationalen Untersuchung berichteten Betroffene, dass sie sich durch BDSM gestärkt fühlten, weil sie sich nicht mehr ohnmächtig, sondern handlungsfähig erlebten – eine Erfahrung, die oft als emotional korrigierend empfunden wird. Auch wenn die wissenschaftliche Beweislage dazu noch jung ist, beschreiben viele diese Form der Auseinandersetzung als tief heilend.
4. Ressource – Wenn BDSM einfach guttut
Und dann gibt es die, für die BDSM schlicht eine Form von Lust ist – auch wenn sie eine schwierige Vergangenheit haben. Für sie ist es weder Traumaaufarbeitung noch Gefahr, sondern schlicht ein Raum, in dem sie sich lebendig fühlen. Vielleicht, weil sie dort Nähe auf ihre Weise erleben können. Vielleicht, weil sie dabei Kontrolle behalten. Oder weil der Körper endlich wieder etwas spürt, das sich gut anfühlt.
Forscher wie Brad Sagarin haben gezeigt, dass BDSM-Praktiken bei vielen Menschen zu einer stärkeren emotionalen Bindung führen können – auch durch hormonelle Effekte wie Oxytocin und Adrenalin. In anderen Studien wird deutlich, dass BDSM eine Quelle von Selbstwirksamkeit, Körperbewusstsein und sogar Freude sein kann – sofern es bewusst, sicher und einvernehmlich praktiziert wird.
Zwei Körper, ein Echo – Beziehung als Resonanzraum
Wenn BDSM auf eine traumatische Biografie trifft, geht es nicht nur um die handelnde Person allein – sondern immer auch um das Gegenüber. In einer Partnerschaft wird BDSM zur Bühne, auf der sich alte Dynamiken neu zeigen oder neu gestalten können. Nicht selten wird dabei der Partner – bewusst oder unbewusst – Teil der inneren Auseinandersetzung. Die Beziehung selbst wird zum Resonanzraum: für Heilung, Wiederholung oder beides.
In reviktimisierenden Konstellationen etwa übernimmt der dominante Teil – oft ungewollt – die Rolle des einstigen Täters. Das „Spiel“ wird zur Fortsetzung des Unausgesprochenen. Schweigen, Ohnmacht und Grenzverschiebung wiederholen sich – diesmal mit der Maske des Einvernehmens. Der Partner wird dann nicht Mitspieler, sondern Statist in einer Inszenierung, deren Regie woanders geschrieben wurde.
Auch in der Reaktualisierung zeigt sich: Es ist nicht der Schlag, der triggert – sondern das Echo im Inneren. Doch je nachdem, wie sensibel das Gegenüber reagiert, entsteht entweder ein sich wiederholendes Trauma – oder ein Moment, der wahrgenommen wird. Der Partner kann hier eine entscheidende Rolle spielen: Ist er achtsam, reagiert er nicht mit Abwehr, sondern mit Präsenz, kann das, was sich körperlich erinnert, erstmals benannt werden.
Im Rescripting schließlich wird Beziehung zur Werkstatt. Hier entstehen neue Erfahrungen, weil das Gegenüber nicht über die Grenze geht, sondern sie mitgestaltet. Die Dynamik lebt vom Dialog – auch dann, wenn er nonverbal ist. Was früher nicht gesagt werden durfte, wird jetzt gespürt. Die Rollen sind bewusst gewählt, nicht reflexhaft angenommen. Beide übernehmen Verantwortung – nicht nur für das Spiel, sondern auch für das, was dahinter liegt.
Und selbst da, wo BDSM zur Ressource wird, ist der Partner mehr als Kulisse. Er ist Zeuge der Selbstermächtigung, Spiegel der Entwicklung, manchmal auch nur stiller Raumhalter. Solche Beziehungen sind nicht „gesund“ im klassischen Sinn. Aber sie funktionieren – weil sie verstanden haben, dass nicht Perfektion zählt, sondern Bewusstsein. Nicht die richtige Technik, sondern der gemeinsame Blick auf das, was wirklich passiert.
Ein Schluss ohne Urteil
Ob Risiko oder Ressource – BDSM ist für Menschen mit traumatischen Erfahrungen weder per se gefährlich noch automatisch heilend. Es kommt darauf an, wie bewusst, wie sicher und wie selbstbestimmt damit umgegangen wird. Die spannendste Frage ist vielleicht nicht, ob BDSM richtig oder falsch ist. Sondern: Was suchen Menschen dort? Und was finden sie?
Denn zwischen Schmerz und Nähe, Kontrolle und Hingabe, Risiko und Vertrauen liegt manchmal genau das, wonach wir uns am meisten sehnen: das Gefühl, wirklich da zu sein – ganz, lebendig und angenommen.